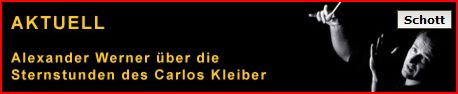Carlos Kleibers Auftritte eine Frage des Honorars?
Rosenkavalier fürs Leben
Carlos Kleiber und das Geld: Dieses Thema schlachtete die Presse immer wieder gerne aus. Aber waren seine Honorarforderungen wirklich so spektakulär, wie oft behauptet wurde? Überzogen gar oder dreist? Dirigierte er etwa nur wegen einer höchstmöglichen Gage? Annahmen, die einmal mehr am vielschichtigen Wesen dieses Mannes vorbeigehen.
Carlos Kleibers Talent, sich zu vermarkten, war spärlich ausgeprägt. Herbert von Karajan war da ein ganz anderes Kaliber. Nur selten ließ sich Kleiber auf Agenten ein. Verhandlungen über seine Auftritte, Verträge und Honorare führte er selbst.
Zu Beginn seiner Karriere verdiente er gemessen an üblichen Bezügen nicht viel und führte Anfang der 60er Jahre ein sehr bescheidenes Leben. Von seiner Mutter Ruth erhielt er keine zusätzliche finanzielle Unterstützung, wie er gelegentlich privat äußerte. Als diese 1967 starb, hatte sich seine Lebenssituation jedoch wesentlich verändert. Inzwischen war er Vater und fest entschlossen, alles dafür zu tun, seine Familie stets gut versorgt zu wissen. Schon damals ließ er verlauten, er dirigiere nur solange, bis dies gesichert sei.
Sein Gehalt an der Stuttgarter Staatsoper war schon recht gut, überschritt jedoch nicht ein vorgesehenes Maximum. Die entsprechenden Verhandlungen hatte er dem Haus nicht leicht gemacht hatte. Doch Kleiber erhielt lediglich Urlaubszugeständnisse und konnte sich keine allzu großen Sprünge erlauben, die seinem Wesen ohnehin fernlagen. Ohne das Bedürfnis nach gehobener Wohnkultur oder Luxus mietete er sich günstig auf dem Land ein. In das Münchner Nobelviertel Grünwald verschlug es ihn später eher durch Zufall. Auch dort lebte er bis zuletzt bescheiden und zurückgezogen.
Ab Anfang der 70er Jahre war Kleiber endgültig davon erlöst, sich in eine feste Anstellung zwängen zu müssen. Viele der hoch dotierten Angebote, die aus aller Welt bei ihm eintrafen, las er nicht einmal, vor allem dann nicht, wenn sie aus den USA kamen. Stimmten jedoch die Voraussetzungen und das Ambiente, trat er stattdessen für erheblich weniger Geld ans Pult. Für einen Dirigenten seines Formats stellte er sicherlich keine unangemessenen Forderungen. So hatte man sich etwa beim SDR in Stuttgart 1970 problemlos geeinigt.
Manche Engagements scheiterten nur vordergründig an Kleibers finanziellen Ansprüchen. Nicht alle waren ihm gewogen, wohl auch nicht der einstige Intendant des Philharmonischen Orchesters Berlin, Wolfgang Stresemann, der ihm einmal ein eher halbherziges Angebot unterbreitete. Nach seinem Nein zu Kleibers Gagenvorstellungen unternahm er keine weiteren Verhandlungsschritte und wunderte sich im Nachhinein, dass er nichts mehr von ihm hörte. Nicht alle waren bereit, dem Jungstar das zu geben, was altbewährte oder willfährigere Kollegen erhielten.
Sternstunden erwarteten jedoch alle von ihm. Meist wurde dabei vergessen, mit welchem Feuereifer Kleiber sich in seine Aufgaben stürzte. Sein für manche zuweilen an Besessenheit grenzender Einsatz beschränkte sich keineswegs auf Proben und Aufführungen. Seine akribischen und intensiven Vorbereitungen begannen oft schon Monate vorher und hatten manchmal zur Folge, dass er für ein Gastspiel andere absagen musste.
Es konnte gefährlich werden, Kleiber vertraglich künstlerische Zugeständnisse zu machen, und diese dann nicht einzuhalten. In Fällen, in denen ihm das Zugesagte verweigert wurde, erwiesen sich selbst eine ausgezahlte Gage und bereits ausgebuchte Säle nicht als Garantie für einen dirigierenden Kleiber. Dabei bewegte er sich rechtlich stets auf der sicheren Seite. Nur wurde dies nie klar nach außen weitergegeben.
In Bayreuth habe er das Übliche bekommen, erzählte mir Wolfgang Wagner. Vermutlich war es ja doch etwas mehr, aber maßvoll im Vergleich zu späteren Gagen. Kleiber, der stets als schwierig galt und mehr und mehr wegen seiner Absagen und Verweigerungen ins Gerede kam, zögerte häufig, einfach nein zu sagen. Er ließ sich nicht selten auf Verhandlungen über Engagements ein, die er gar nicht wollte. Anstelle einer Absage erwies sich für ihn die Honorarschraube als bewährtes Mittel.
Die sollte auch 1977 bei den Elektra-Aufführungen in Covent Garden funktionieren. Doch zur Verblüffung Kleibers akzeptierte die Royal Opera seine Forderungen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als nach London zu reisen. Für das Opernhaus in San Fransisco, an dem er 1977 sein USA-Debüt geben sollte, verlief das überraschende Versagen seiner Honorarschraube weniger glimpflich. Kleiber stand dem Engagement zunächst nicht abgeneigt gegenüber, solange dabei die Zusammenarbeit mit Wolfgang Windgassen in Aussicht stand. Als der Sänger jedoch starb, erlosch Kleibers künstlerisches Interesse schlagartig. Er wusste, dass ihn fast alle engagieren wollten, nur nicht, dass einige bereit waren, dies zu erreichen, koste es was es wolle. Kleiber fassungslos über das Versagen seiner Taktik, denn er muss immense Summen gefordert haben sagte letztendlich zum Entsetzen der Beteiligten wegen Krankheit ab. Eine der wenigen, vielleicht die einzige Episode, in der die Krankheit möglicherweise vorgeschoben war.
Doch solche spektakulären Geschichten hatte Kleiber nicht beabsichtig. In der Regel lag es ihm fern, zu pokern. Er wusste, was er wert ist und beanspruchte, was er für angemessen hielt. Bot man ihm von vornherein mehr, lehnte er dies nicht ab. Stimmten die Bedingungen und das Vertrauen zum Gegenüber, stand einer Einigung kaum etwas im Wege. Meist waren für einen Auftritt Kleibers nicht die Gagen ausschlaggebend, sondern das persönliche Engagement ihm in irgendeiner Weise naher Menschen.
In München fühlte er sich wohl. Die Stadt wurde zu seiner Hochburg mit anfangs reizvollen künstlerischen Herausforderungen. An keinem anderen Ort dirigierte Kleiber so oft und so viele Werke. Aber warum immer wieder den Rosenkavalier?, fragte ich einen Freund Kleibers. Wegen der regelmäßigen Einkünfte, mit denen er schon in Stuttgart seinen Lebensunterhalt sicherte, so die Antwort. Seiner Gewissenhaftigkeit und seinem Eifer tat dies keinen Abbruch. Zunehmend trugen gewiss künstlerische wie auch persönliche Gründe dazu bei, dass Neuninszenierungen immer seltener wurden. Allein schon durch den Weggang des Intendanten Günther Rennert lockerte sich Kleibers Verhältnis zur Staatsoper erheblich.
Wie Wolfgang Sawallisch, Generalmusikdirektor und später Staatsoperndirektor in München, mir erzählte, konnte es passieren, dass Kleiber vor einer Aufführung plötzlich doch noch eine höhere Gage forderte. Kein Wunder, denn in den 80er Jahren trat er merklich seltener ans Pult und verlangte dementsprechend mehr. Offenbar führte dies aber nicht zu Konflikten. Kleiber war überall ein Garant für volle Häuser und sorgte für öffentliches Aufsehen.
Für manchen Intendanten bedeutete es den Höhepunkt der Amtszeit, ihn wenigstens einmal zu gewinnen. Andere verzichteten lieber auf diese Ehre, insbesondere während der rasanten Aufstiegsphase Kleibers. Grischa Barfuss lehnte eine Zusammenarbeit mit ihm 1964, noch vor seinem Amtsantritt als Generalintendant an der Deutschen Oper am Rhein, ab: Kleiber mache zu viel Ärger. In Stuttgart fiel er 1972 nach dem Intendantenwechsel zum Leidwesen des Publikums in Ungnade. 1974 blieb August Everding an der Hamburgischen Staatsoper unnachgiebig, als Kleiber auf zusätzliche Falstaff -Proben im Orchestergraben bestand. Die Premiere fand ohne Kleiber statt. Eine später im Jahr geplante Rosenkavalier-Aufführung ging im Ärger über Kleibers Spesenerwartungen und wegen dessen folgender Krankmeldung unter.
Kleiber war ein durchaus sparsamer Mensch, der dazu neigte, Dienste mit Freikarten zu vergüten, sogar die von Anwälten. Er ließ sich auch gerne zum Essen einladen, ohne dabei nobel speisen zu müssen. Er hatte wenig Vertrauen in Banken, wie mir ein guter Bekannter Kleibers berichtete, und fürchtete um sein Erspartes. Auch hier spielte der Einfluss seines Vaters Erich Kleiber eine nicht unwesentliche Rolle, der durch die Weltwirtschaftskrise einen finanzielle Einbruch erlebt hatte. Und obwohl sein Vater sehr gut verdient hatte, musste Carlos Kleiber erfahren, welche Summen dieser für den Lebensunterhalt seiner Familie sowie für teure Ausbildungen benötigte und wie er dann im besten Dirigentenalter plötzlich verstarb. Auch ihm wurde nachgesagt, bei Bedarf seine Gage schon mal nach oben zu korrigieren.
Aber wäre es Carlos Kleiber nur um Geld gegangen, hätte er seine Einnahmen durch Gastspiele und Plattenproduktionen vervielfachen können. Gewiss konnte ihn da und dort ein sattes Honorar leichter überzeugen, beispielsweise bei den Wiener Neujahrskonzerten 1989 und 1992, die er nicht unbedingt hätte dirigieren müssen. Manch alter Weggefährte, der sich endlich Beethovens oder Schuberts Neunte von ihm gewünscht hätte, schüttelte über diese Engagements den Kopf. Mit dem Gerücht, dass Kleiber die Tonträgerrechte an den Mitschnitten quasi versteigert habe, nährten die Medien den Verdacht, dass Kleibers Honorar die wesentliche Rolle gespielt habe. Ein zweites Mal wollte Kleiber sich diesem Rummel eigentlich nicht aussetzen. Dass er 1992 für den verstorbenen Leonard Bernstein einsprang, hatte vor allem persönliche Gründe. Die Musikwelt dankt es ihm bis heute.
Auch sein Debüt an der Met, dem weitere Auftritte folgten, wurde ihm durch ein wohl einmalig opulentes Angebot versüßt. Doch auch hier bewog ihn das Engagement eines Mannes, nämlich das Luciano Pavarottis, zu diesem Schritt. Offenbar war er New York die Gage wert. Noch heute schwärmt man dort von seinen Aufführungen.
Von großzügigen Honoraren ließ sich Kleiber nie manipulieren. Lag ihm etwas nicht, dann ließ er es, egal wie hoch die Angebote gingen. Das zeigte sich deutlich in den späten Jahren, als er zwar noch sporadisch für Film-Produktionen von Leo Kirchs Unitel oder Aufführungen an der Met dirigierte, aber ebensogut auch honorarfrei für einen guten Zweck bei den Berliner Philharmonikern oder seiner Familie zuliebe in Ljubljana. Auch für die Zusage seiner Japan-Tournee mit der Wiener Staatsoper 1994 war nicht die offenbar horrende Gage ausschlaggebend, sondern sein Wunsch, einmal mehr Japan zu sehen. Und statt auf weitaus lukrativere Angebote einzugehen, bestritt er seine letzte Konzerttournee 1999 nach persönlicher Fürsprache lieber mit dem Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks.
Als Kleiber 1996 in Ingolstadt als Honorar einen Audi A8 erhielt, löste er damit ein seltsames Medienecho aus. Kleiber in der Provinz nur wegen eines Autos? Unterschlagen wurde nicht nur, dass sich dort bei den Sommerkonzerte an Donau und Altmühl einige berühmte Kollegen des Öfteren ein Stelldichein gaben, sondern auch, dass der Gegenwert des Fahrzeugs keineswegs einer überhöhten Gage entsprach. Dabei steht außer Frage, dass ihm das Auto gefiel und ihn das Angebot lockte.
Kleiber lag es zeitlebens fern, Geld um seiner selbst willen oder Reichtümer anzuhäufen. Am Ende starb er mit der Gewissheit, genau das Ziel erreicht zu haben, das er sich Jahrzehnte zuvor gesetzt hatte.
Alexander Werner